Habe ich das verdient?
Privilegien werden häufig verschleiert. Aber wer über sie schreibt, sollte die eigenen kennen. Unsere Autorin ist auf Spurensuche gegangen.
Sebirien.Groß und fett grinst das Wort von der Tafel in den Klassenraum hinein. Zehn Kindergesichter starren zurück. Unsere neue Klassenlehrerin zeigt auf eine Weltkarte. Sie erklärt etwas zu Russland, menschenleeren Weiten, Schnee, Hitze, so was. Ganz genau weiß ich das heute nicht mehr. An den Rechtschreibfehler kann ich mich allerdings genau erinnern. Nicht, weil ich mit neun gewusst hätte, dass man Sibirien mit drei I schreibt. Sondern weil mir hier zum ersten Mal bewusst wird, dass ich privilegiert bin. Und mir das peinlich ist.
Den Fehler entdeckt meine Mutter am Nachmittag in meinem Sachkundeheft: „Sibirien wird mit I vorn geschrieben“, sie tippt mit der Fingerspitze auf das Wort in Kinderschreibschrift. Ich schüttelte den Kopf, sage, dass das genau so an der Tafel stand. Mama lacht. Sie glaubt mir nicht. Und holt Band „SCH-STAL“ aus der schwarz-roten Brockhaus-Ausgabe meiner Großeltern. Dort steht es, Sibirien, mit drei vorwurfsvollen Is. Gut, dass heute Elternabend in der Dorfgrundschule ist, sagt sie, da kann sie ja mal gucken, was wirklich an der Tafel stand.
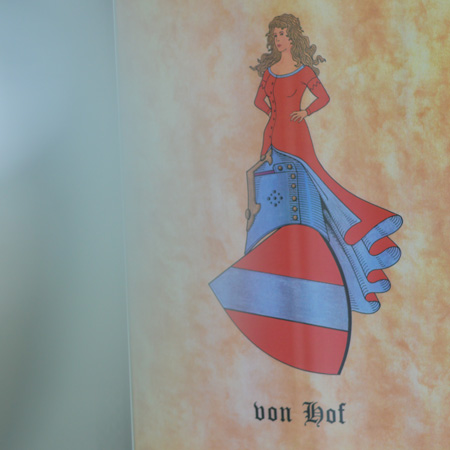
Mir wird heiß. Ich stelle mir vor, wie meine Mutter vor meine Lehrerin tritt und sie auf den Fehler hinweist. Die Lehrerin hatte doch gerade erst wegen unseres Nachnamens gestutzt, „von“, diese blöde Präposition, der Blinddarm eines Nachnamens, völlig nutzlos, schmerzt manchmal.
Was soll sie denken, wenn meine Mutter sie korrigiert? Ich weine, bitte meine Mutter, nichts zu sagen. Ich wünsche mir, dass der Brockhaus verschwindet. Dass ich nicht so heiße. Dass meine Mutter nicht jeden Fehler findet.
Zwanzig Jahre später.
Als Journalistin spreche ich mit meinen Interviewpersonen häufig über Privates. Ich frage nach Kindheit und Jugend, Eltern, Rebellionen und Herausforderungen, Schwierigkeiten, Diskriminierungserfahrungen, Privilegien. Meine eigenen habe ich allerdings noch nie offengelegt. Musste ich ja auch nicht. Schließlich halten wir den Journalismus schön neutral, also auf einer Seite. Von der anderen erwarten wir einen Striptease.
Das so entstandene Machtgefälle verschleiern wir zusätzlich, indem wir uns aus den Geschichten zurückziehen, uns unter dem Argument, den Protagonistinnen und Protagonisten keine Sichtbarkeit zu klauen, unsichtbar machen. Aber Macht schrumpft nicht, wenn man sie versteckt. Sie wird größer. Das möchte ich mit diesem Text ändern. Und mich fragen:
Von welchen Privilegien profitiere ich?
Ich gebe die Frage bei Google ein. Und finde: Privilegientests. 30 bis 100 Aussagen sollen aufzeigen, welche Privilegien man so hat. Für jede bejahte erhält man Punkte. Etwa: Ich bin weiß. Ich bin heterosexuell. Ich fühle mich mit dem Geschlecht wohl, in dem ich geboren bin. Ich wurde nie wegen meines Glaubens bloßgestellt. Ich habe Abitur gemacht. Mein Privilegienkonto füllt sich schnell. Ich wurde nie sexuell belästigt. Ich stutze. Nein. Ich bin ein Mann. Nein. Mir wurde nie gesagt, ich sei übergewichtig oder zu dünn. Nein. Ich werde ratlos. Und frage mich, was Privilegien eigentlich sind. Vorteile? Sonderrechte? Kann man sie erarbeiten, sind sie angeboren? Kann ich gleichzeitig privilegiert und nicht privilegiert sein? Ich klappe den Laptop zu und schaue in den Spiegel.
Um mehr über mein Rad zu erfahren, rufe ich Antje Prust an. Antje, 40, gibt seit drei Jahren Anti-Diskriminierungsseminare. Die Schauspielerin hat es gestört, dass man Sexismus häufig ohne Transfeindlichkeit denkt, meistens auch ohne Rassismus oder Homophobie. Deshalb hat sie mit einigen anderen einen intersektionalen Workshop ausgedacht, der verdeckte Diskriminierungen beleuchtet – und Privilegien hinterfragt. Antje beginnt die Workshops damit, dass alle Teilnehmenden die Stationen ihres Lebens, Schule, Ausbildung, Job, benennen. Dazu fragt sie:
Musstet ihr häufig euren Namen buchstabieren?
Hattet ihr Nebenjobs?
Konntet ihr euch unbezahlte Praktika leisten?
Haben eure Eltern Abitur?
Einen Hochschulabschluss?
Mir fällt die Episode mit meiner Klassenlehrerin ein. Und wie meine Eltern mich Lateinvokabeln abfragten. Die beiden haben sich im Hörsaal kennengelernt, später kurz nacheinander Juraexamen abgelegt. Als ich etwa fünf war, nimmt meine Mutter mich mit in die Unibibliothek. Überall Bücher und Menschen, die sich so still über sie beugen, dass schon Räuspern wie Schreien klingt.
Auf der Heimfahrt bleibt mir ein oranges „Nimm2“-Bonbon im Hals stecken, das Mama kaufte, weil ich brav war. Vermutlich kann ich mich nur deshalb an die Bibliothek erinnern. Denn damals fand ich das stinklangweilig, Bücher gab es auch bei uns zuhause.
Jetzt weiß ich: Das ist ein Privileg. Studien sagen, dass Kinder, die in ihren Elternhäusern mit Büchern in Kontakt kommen, später besser im Lesen, Schreiben und sogar im Rechnen sind.
Als ich beginne, ein Privileg zu benennen, fallen mir gleich drei weitere ein. Ob ich als Kind mit meinen Eltern im Urlaub war? Klar. Ob ich mal hungrig ins Bett gegangen bin? Nein.
Mit Privilegien ist es wie mit Dominosteinen. Fällt eins, fallen weitere.
Antje sagt, das ginge vielen so. Auch, dass sich viele Menschen unwohl dabei fühlen, einige in die Defensive gleiten, als müssten sie ihr Leben rechtfertigen. Ich kenne das. „Aber Privilegien sind ja nichts Schlechtes, daraus entsteht kein Vorwurf“, sagt Antje. Ich frage mich, ob ich nur die bin, die ich bin, weil es mir so gut ging in meinem Leben. Und ob meinen Eltern das bewusst ist? Ich beschließe, sie zu fragen.

Eine S-Bahn, einen ICE und 40 Autominuten später bin ich da, wo ich herkomme. In dem Dorf zwischen Göttingen und dem Brocken, wo es früher mehr Kühe als Menschen gab und mittlerweile nicht mal mehr viele Kühe. Meine Eltern wohnen seit 25 Jahren hier, in dem Haus mit dem roten Dach, indem auch meine Großeltern lebten, bis sie starben.
Ich gehe durch den Garten und dann ins Haus.
Papa will wissen, worum es in dem Artikel geht. Privilegien? Aha. Er, jetzt mehr Jurist als Vater, fragt nach einer Definition. Sonst habe man doch keine Basis für eine Unterhaltung. Ich bitte ihn, einfach zu assoziieren. Und frage, ob er sich für privilegiert hält. Er überlegt. Und bejaht. Privilegien seien für ihn persönliche Vorteile. Etwa, sich etwas leisten zu können. Bei Edeka nicht auf den Milchpreis schauen zu müssen. Urlaub. Mitgliedschaft im Golfclub. Unser Haus. Und dass er sich seine Zeit als Selbstständiger einteilen kann, wie er will.

Mama kommt dazu. Sie findet, eine intakte Familie sei ein Privileg, Menschen, auf die man sich verlassen kann, wenn einem die Beine weg knicken. Und Abitur und Studium. Ja, Bildung, das sei ein Privileg. Als Kind litt sie unter einer chronischen Krankheit. Niemand habe damit gerechnet, dass sie studieren könne. Hat sie aber.
Sind meine Eltern stolz darauf? Beide denken nach. Wir ziehen uns bequeme Hosen und Birkenstocks an und angeln Smarties aus dem Küchenschrank. Mama holt die Kiste mit Kinderbüchern, aus denen sie mir früher vorlas.
Stolz zu sein auf Privilegien, das fühlt sich für mich etwa so falsch an, als wäre man auf seine Augenfarbe stolz. Man hat nichts dafür getan und kann sie nicht ändern.
Beide finden, sie haben etwas Gutes aus ihrem Leben gemacht. Und mir viel ermöglicht. Das sei doch kein Privileg, für das man sich schämen müsse.
Ich bin mir nicht sicher. Viele Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Nicht alle können es sich leisten. Einige Privilegien von heute hätten sie sich im Gestern hart erarbeitet, sagen meine Eltern. Das Studium etwa ist ihnen nicht zugefallen, Erfolg im Job auch nicht. Mein Vater schlief im Büro, meine Mutter arbeitete am Wochenende. Vielleicht bedeuten Privilegien nicht, dass man nicht schwer arbeiten muss. Sondern dass man arbeiten kann.
Wenn man in einem homogenen Milieu unterwegs ist, wird aus Privilegien schnell Normalität. Und wenn man ihn doch spürt, den unsichtbaren Motor am Fahrrad, bemüht man sich, ihn kleinzureden oder zu verstecken. Wie das geht, habe ich zum ersten Mal in der Grundschule gespürt.
Was macht man, wenn man seine Privilegien kennt? Sich schämt? Die Balance des Universums wieder herstellen will? Antje sagt, so geht es vielen. Ich soll keine „privilege tears“ weinen, das sei nicht konstruktiv, reproduziere bloß, wofür ich mich schäme. Es sei ein bisschen so wie bei Spiderman: Aus großer Macht folgt große Verantwortung.
Je mehr man über die eigene weiß, desto eher kann man sie teilen. Das beginnt bei Intoleranz gegenüber rassistischen Witzen und endet bei dem Jobangebot, das man an die weitergibt, die sonst nie von der Stelle erführe. Und ja, auch Verzicht gehört dazu.
Verzicht?
Auf viele Privilegien kann ich nicht verzichten, weil ich mich nie für sie entschieden habe. Welche Farbe meine Haut hat etwa, wen ich küssen möchte oder wie viele Bücher in meinem Kinderzimmer stehen. Verzichten kann man aber auf die Möglichkeiten, die Privilegien bieten. Zum Beispiel? Wäre dieses Coaching bezahlt worden, erklärt Antje, hätte sie die Anfrage an ihre Co-Trainerinnen weitergegeben, die rassifizierten Gruppen angehören. Nimmt sie an einer Diskussion teil, achtet sie auf den Raum, den sie beansprucht. Geht es also um Macht, gibt sie ab. Das kann unangenehm werden, klar. Wollen wir in einer gerechteren Welt leben, sollten wir das in Kauf nehmen.
Vielleicht ist das wahr, überlege ich. Mit welchem Rad wir durch die Welt fahren, bestimmen Hautfarbe, Geschlecht, Sexualität, Aussehen, Religion, Gesundheit, Kontostand und das soziale Milieu, aus dem wir kommen. Ob wir absteigen, jemanden mitfahren lassen oder den Motor drosseln, bestimmen wir.